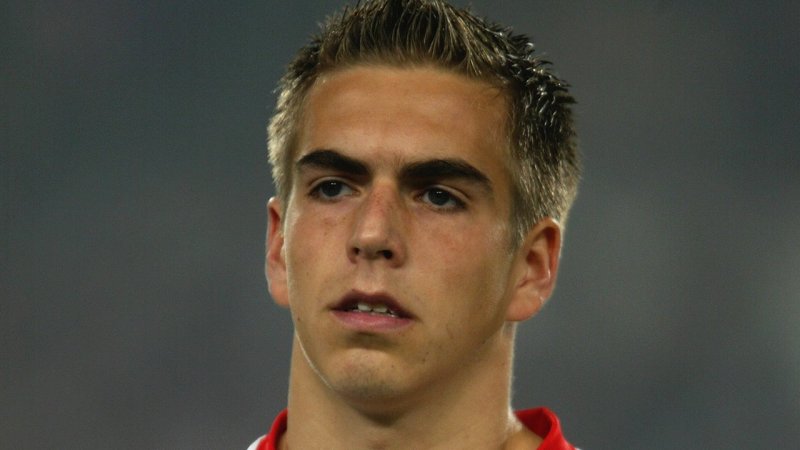Mittlerweile bekommst du bei einem Spieler während einer Szene mehrere Millionen Datenpunkte. Da wird alles haargenau analysiert und in Relation gesetzt. Was macht der Spieler in welcher Situation, wo geht sein Blick hin, wie bewegt er sich, etc.
"Moneyball" im Baseball als Vorreiter
Und Brentford war nicht allein. Was im Baseball mit "Moneyball" begann, hat sich im Fußball zur stillen Revolution entwickelt. Der Fußball hat ein neues Vokabular gelernt: xG-Werte, Packing-Raten, Expected Transfer Value. Daten bestimmen, wer auf dem Radar erscheint – und wer von ihm verschwindet.
"Mittlerweile bekommst du bei einem Spieler während einer Szene mehrere Millionen Datenpunkte. Da wird alles haargenau analysiert und in Relation gesetzt. Was macht der Spieler in welcher Situation, wo geht sein Blick hin, wie bewegt er sich, etc.", erklärte Markus Brunnschneider, Fachbereichsleiter Spiel- & Taktikanalyse, Scouting und Kaderplanung am Internationalen Fußball Institut (IFI) gegenüber LAOLA1.
Es ist ein Paradigmenwechsel, der das Scouting grundlegend verändert hat. Und er ist noch lange nicht abgeschlossen.
Vier Wege des Scoutings
Grundsätzlich lassen sich im modernen Fußball vier Wege unterscheiden, um Talente zu finden:
Scouting-Typ | Beschreibung | Tools | Vorteile | Risiken |
|---|---|---|---|---|
Klassisch | Beobachtung vor Ort, Gespräche | Wyscout, Netzwerke | Persönlichkeit, Menschenkenntnis | Subjektiv, schwer skalierbar |
Datenbasiert | Objektive Werte, Statistiken | StatsBomb, TransferLab | Objektivität, Vergleichbarkeit | Daten je nach Liga besser/schlechter |
KI-gestützt | Machine Learning erkennt Muster, Prognosen | SAP Sports One, IBM Watson | Enttarnt verborgene Potenziale | mentale Faktore kaum messbar |
Hybrid | Daten filtern vor, Scouts validieren vor Ort | Eigene Modelle, Systeme | Beste beider Welten | Hoher Aufwand |
Brunnschneider spricht dabei im besten Fall von vier Stufen während eines Scouting-Prozesses.
Datenbasierte Vorselektion
Videoscouting
Livebeobachtung im Stadion
Netzwerk & Kontakt mit Beratern.
"Die Punkte eins und zwei sind in Bezug auf Effizienzsteigerung der Wichtigste - vor allem für kleinere Vereine mit weniger Mitarbeitern. Du kannst per Video und Daten einfach deutlich schneller die relevanten Spieler identifizieren als über reines Livescouting."
Physiker revolutionieren den Fußball

Diesen Weg gingen auch einige Pioniere in Europa. In Dänemark setzte der FC Midtjylland früh auf Datenanalyse, nachdem Brentford-Besitzer Benham 2014 den Klub übernommen hatte. Nur ein Jahr später feierte man die erste Meisterschaft.
In England wiederum revolutionierte Ian Graham, ein Physiker aus Cambridge, die Transferstrategie des FC Liverpool – und legte damit das Fundament für die Klopp-Ära. Graham baute eine eigene Datenanalyse-Abteilung mit anfangs fünf Mitarbeitern auf.
Die rasante Entwicklung der "Reds" unter Jürgen Klopp verdanken die Fans auch der datenbasierten Transferstrategie. Während zum Beispiel Vorgänger Brendan Rodgers dieser eher kritisch gegenüberstand, war der Deutsche voll überzeugt.
Klopp als Freund der Entwicklung
Bestes Beispiel hierfür sind die Transfers von Mohamed Salah und Andrew Robertson. Der Ägypter galt aufgrund seiner Chelsea-Zeit als Premier-League-Flop, seine Daten zeigten aber großes Potenzial und dass er perfekt ins System passen würde.
Klopp gab daraufhin das Go und der Rest ist Geschichte. Der verantwortliche Physiker Graham sagte dazu mal in einem Interview: "Wir konnten kaum glauben, dass wir ihn bekommen. Unverständlich, dass Manchester City und Arsenal nicht dran waren."
Ähnlich wurde Robertson trotz des Abstiegs von Hull City aufgrund seiner Defensivaktionen und seiner progressiven Passquote gescoutet. Unter Klopp entwickelte er sich zwischenzeitlich zum besten Linksverteidiger der Welt.
Ein Unterschied zu Vorgänger Rodgers? Der damalige Cheftrainer wollte unbedingt Adam Lallana, die Daten schlugen Salzburgs Sadio Mane als günstigere und jüngere Variante vor. Rodgers holte trotzdem Lallana und Mane kam erst zwei Jahre später unter Klopp nach Liverpool.
Doch um diese Daten verstehen zu können, braucht es kein Physik-Studium oder vergleichbares. Das internationale Fußballinstitut, kurz "IFI", bietet Kurse und Ausbildungen zu eben jenen Themen an.
Günstig kaufen – teuer verkaufen
Mittlerweile ist dieses System im internationalen Fußball weit verbreitet und hilft vor allem Teams mit niedrigerem Budget, den Anschluss nicht zu verlieren.
Brighton & Hove Albion wiederum perfektionierte das Modell, junge Talente unter dem Radar zu holen: Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister, Kaoru Mitoma. Alle mithilfe von Daten gefunden, alle später für Millionen weiterverkauft.
Doch klar ist auch: Daten sind kein Allheilmittel. Sie können keine Führungsstärke oder Anpassungsfähigkeit messen. Die besten Entscheidungen entstehen noch immer aus der Kombination von Zahlen und Menschenkenntnis.
Salzburg als Vorreiter – Sturm auf der Überholspur

Der datengetriebene Wandel macht auch in Österreich keinen Halt.
Wie in vielen Bereichen ist auch hier Red Bull Salzburg die klare Nummer eins. Die "Bullen" nutzen für ihr Scouting den klassischen hybriden Ansatz, der die fortschrittliche Datenanalyse mit dem LIVE-Scouting kombiniert.
Aufgrund ihres großen Netzwerks und des Multi-Club-Ownerships fanden dadurch viele vielsprechende Talente den Weg nach Österreich. Getreu dem Motto: Jung, dynamisch und erfolgshungrig.
Einen ähnlichen Weg hat der SK Sturm Graz in den Jahren unter Ex-Sportchef Andreas Schicker eingeschlagen. Auch dort entwickelte sich das Scouting-System anhand von Daten auf ein extrem hohes Niveau, viele junge Talente wurden billig eingekauft und Jahre später teuer weiterverkauft.
Mit auch ein Grund, warum die "Blackies" die Lücke zu Salzburg mittlerweile komplett schließen konnten.
Für kleinere Vereine kann Daten-Scouting ein Game-Changer werden.
"Game-Changer"
Und selbst kleinere Klubs entdeckten das Potenzial. Ex-WSG-Trainer Thomas Silberberger bestätigte 2023 im "Kurier", dass in Tirol längst mit KI-Tools gearbeitet wird.
"Für solche Klubs kann das ein Game-Changer werden. Angenommen du holst Spieler direkt aus einer Akademie aus ihrem Herkunftskontinent wie Afrika oder Südamerika ohne eine "Zwischenstation" in einem anderen europäischen Land wie Portugal. Mit der richtigen Integrations- und Entwicklungsstrategie ist es nicht unwahrscheinlich einen solchen Spieler mit einem signifikanten Transfergewinn in einen Zielmarkt wie England zu verkaufen. Wenn du dann das Budget wieder in die Infrastruktur steckst oder dir einen Experten im Datenscouting dazuholst, dann kann man extrem viel rausholen", so Brunnschneider.
Fazit
Ob Brentford oder Brighton, Liverpool oder Salzburg – der Trend ist eindeutig: Informationen strukturieren, Risiken minimieren, Potenziale früh erkennen - Österreich ist Teil dieser Entwicklung, nicht bloß Zuschauer.
Die Zukunft des Scoutings liegt aber nicht allein in Algorithmen, sondern in der intelligenten Verbindung von Technologie und Menschenkenntnis – und in der Fähigkeit, aus vielen Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen.